Debatte
Michael Haller | Spannungsfelder des narrativen im Journalismus: Zwischen Fakten und Fiktion
Journalismus muss für „Nonfiction“ stehen: Die im angloamerikanischen Raum von jeher übliche Unterscheidung zwischen „Fiction“ und „Nonfiction“ bringt den Unterschied auf den Punkt. Es geht nicht um die Frage nach einer tieferen Wahrheit, die ein fiktionaler Roman mitunter besser einzulösen vermag als ein journalistischer Tatsachenbericht. Es geht vielmehr um den Status der Aussagen: Die Leser eines journalistischen Textes erwarten, dass die darin getroffenen Sachaussagen – wer alles, was genau, wann und wo und wie – zutreffend und die Schilderungen authentisch sind. Auch eine Erzählung hat im Journalismus zutreffend und somit im juristischen Sinne wahr zu sein. In der Welt des Rechts sind „wahr“ und „falsch“ Kriterien, die sich auf „Tatsachen“ beziehen. Und mit „Tatsachen“ sind Aussagen gemeint, die unstrittig zutreffen, also „intersubjektiv verifiziert“ sind. Einfacher gesagt: Aussagen, die von mehreren unabhängigen Zeugen bestätigt werden.
Mit seinem Kolportageroman „Der Auftrag – oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter“ (1986) schrieb Friedrich Dürrenmatt eine sprachlich brillante Novelle, die genau vierundzwanzig Sätze auf hundert Seiten Länge umfasst. Im Vorwort sagte Dürrenmatt: „Nicht ich trieb die Sätze, wohin ich wollte, die Sätze trieben mich, wohin sie wollten.“ Treffender und knapper lässt sich der Unterschied zwischen literarischer Dichtung und journalistischer Reportage nicht beschreiben. Im Unterschied zum Literaten muss der Journalist dafür sorgen, dass die Sätze, die er schreibt, ihn nicht entführen und aus dem Dokumentarischen wegleiten. Diese Gefahr der Verführung in Richtung Fiction wird umso grösser, je trivialer das Thema und magerer die Recherchen waren: Langweilige Geschehnisse spannend zu erzählen, ist ein Kunststück; Spannendes hinzuzudichten, ist deutlich einfacher. Dieses Problem hat Egon Erwin Kisch, der wohl berühmteste Reporter des 20. Jahrhunderts, mit einer Moritat veranschaulicht: In seiner autobiografischen Schrift „Debüt beim Mühlenfeuer“(1942) bezichtigte er sich selbst der Lüge. Er habe als junger Prager Nachwuchsreporter in seinem Bericht über einen Großbrand die Unwahrheit deshalb geschrieben, weil er am Ort nicht recherchiert und somit auch nicht genau hingesehen hatte („offenbar ist die direkte Beschreibung der Wirklichkeit weit schwieriger“). Er zog daraus den Schluss: „Ein Chronist, der lügt, ist erledigt“. Im Übrigen: Manches weist darauf hin, dass sich diese Episode so gar nicht ereignet hat, Kisch sich diese Geschichte wohl aus pädagogischen Gründen ausgedacht hat – also eine moritatische Lüge in einer romanhaft verfassten Autobiografie. Kisch würde vermutlich sagen: Ich war hier ja kein Chronist (= Berichterstatter), sondern Literat.

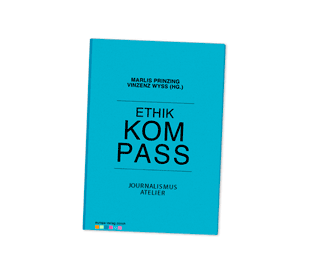

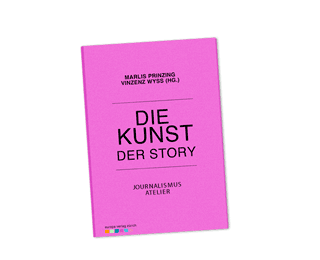


Neueste Kommentare